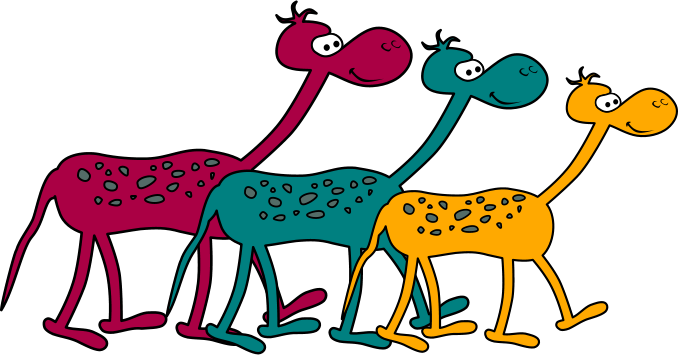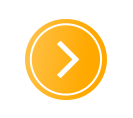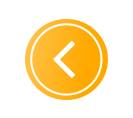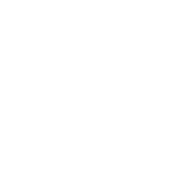Kieler Kloster
An dieser Stelle ließ der Stadtgründer, Herzog Adolf IV. von Schauenburg und Holstein (*1205, †1261), im Jahr 1242 ein Kloster errichten und stiftete es dem Orden der Franziskaner. Später trat der Herzog selbst ins Kloster ein und wurde schließlich in der Klosterkirche begraben. Ansonsten ist nur wenig über die Geschichte des Klosters bekannt. Im mittelalterlichen Kiel wird das Kloster wahrscheinlich eine bedeutende Rolle gespielt haben. Ab dem 14. Jahrhundert wurden die Städte zu den Treibern der wirtschaftlichen Entwicklung und führten zu einem gewissen Wohlstand, wie es ihn jahrhundertelang nicht gegeben hatte. Daher wurden zahlreiche Menschen aus der Region fast magisch angezogen. In den Städten versprachen sie sich ein besseres und vor allem freieres Leben als auf dem Land. Manchmal wurden diese Träume jedoch nicht Realität und die oftmals verarmten Menschen. Sie fanden in den Klöstern der Städte ein neues Zuhause – beispielsweise im Kieler Franziskanerkloster. Im Zuge der Reformation wurde das Kloster 1530 aufgelöst und die Gebäude anderweitig genutzt. Beispielsweise bezog die 1665 gegründete Kieler Universität die Klosteranlagen. Im 18. Jahrhundert waren die Klosteranlagen jedoch so sehr verfallen, dass die Universität umzog. Erst umfassende Sanierung des 19. Jahrhundert retteten die Anlagen vor dem weiteren Verfall. Aufgrund seiner zentrumsnahen Lage wurde das Kloster im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört. Teile des Klosters wurden nach dem Krieg wiederaufgebaut. In den 1980er und 1990er Jahre wurde die Anlage umfassend restauriert und erneuert. Im Jahr 1999 wurde im vereinfacht wiedererbauten Kirchturm ein Carillon eingebaut – ein spielbares Glockenspiel.
Alte Ansicht vom Kieler Kloster

Kirchturm des ehemaligen Klosters