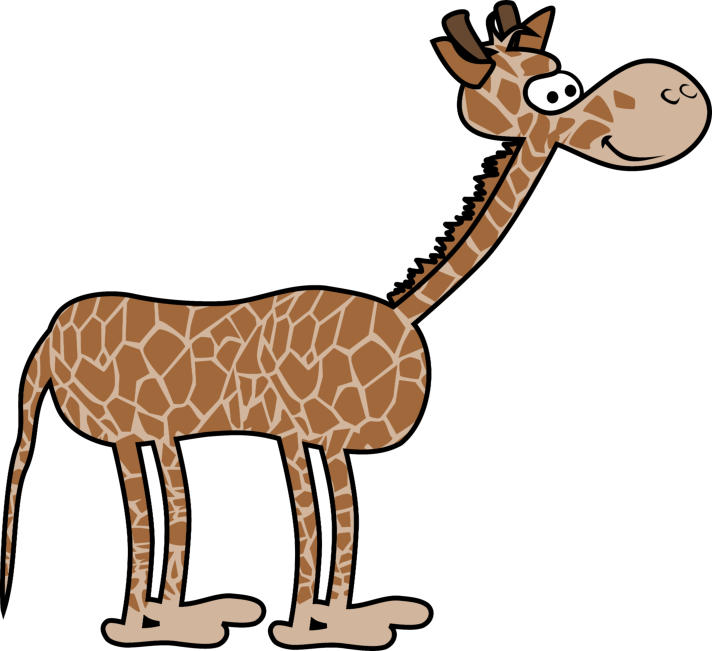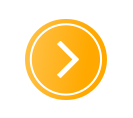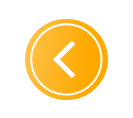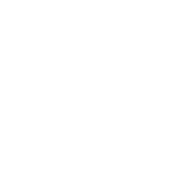Verden in der Kolonialzeit
Bis in die 1880er Jahre war die Spielzeugauswahl noch sehr begrenzt. Man nutzte Holz, Porzellan oder andere keramische Stoffe, um die „Natur“ in das Kinderzimmer zu holen. Da diese „Werkkörper“ schwer zu modellieren waren, bildete das Spielzeug damals kaum die Realität nach. Im späten 19. Jahrhundert wurden erstmals Thermoplaste hergestellt, Kunststoffe die sich in einem bestimmten Temperaturbereich verformen lassen. Diese frühen Kunststoffe waren jedoch leicht entzündlich. Im frühen 20. Jahrhundert entwickelten gleich zwei Spielwarenfirmen (Lineol und O. & M. Hausser) in Deutschland formbare Massen die nicht brennbar waren und auf frühere Plastik- Arten verzichteten. Die unterschiedlichen Rezepturen beinhalteten Holzmehl, Kreide, Leim, Leinöl, Baumharz, Kasein (Milch-Protein) und Kaolin (Mineral). Damals kam es zu einem gesellschaftlichen Wandel, bei dem Kinder zunehmend als eigenständige Individuen gesehen wurden, die durch Spielzeug nicht nur unterhalten, sondern auch gebildet werden sollten. Gerade die Tierfiguren förderten das Lernen über Tiere und die Natur und passten sich so dem neuen Verständnis von Kindheit und Erziehung an. Ablenkung von den Kriegsfolgen, Sammel- leidenschaft, wirtschaftlicher Wohlstand, technische Innovationen und gesellschaftliche Veränderungen trugen dazu bei, dass Spielzeugfiguren zu einem festen Bestandteil der Kindheit wurden. Um 1900 spielten viele Kinder gerne mit exotischen Tierfiguren, weil diese den Wunsch nach Abenteuer und Freiheit stillten und die Faszination für fremde Länder und koloniale Entdeckungen der Zeit widerspiegelten. Zeitgleich erfreuten sich exotische Ausstellungsstücke in Museen und Zoos wachsender Beliebtheit.
Zwischen 1884–1919 besaß Deutschland einige
Kolonien, vor allem in Afrika. Auch wenn diese
Kolonialzeit keine 50 Jahre andauerte, hatte
dieser Länderbesitz eine bedeutende Rolle für die
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur.
Zeitungen, Bücher und Werbung verbreiteten ein
verklärtes Bild der Kolonien, das den Besitz über
fremde Gebiete als selbstverständlich darstellte.
Während die politische Führung und die
Oberschicht den Kolonialismus unterstützten, gab
es auch Kritiker, die ihn als ausbeuterisch und
unmoralisch ansahen.
Nach dem Ersten Weltkrieg verlor Deutschland
durch den Vertrag von Versailles (1919) all seine
Kolonien an die Siegermächte. Dennoch wirkten
koloniale Denkweisen lange nach – etwa in
Straßennamen, kolonialen Vereinen oder
nostalgischen Erinnerungen an das "verlorene
Kolonialreich".