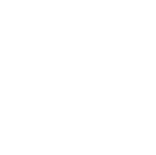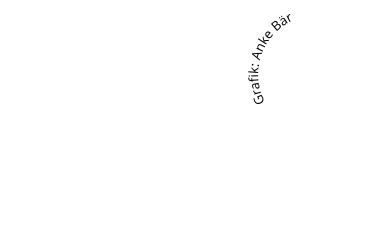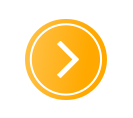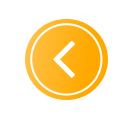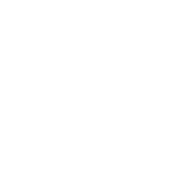Kaak
Die hier stehenden Löwenfiguren bewachten höchstwahrscheinlich einst den Zugang zum Dom. Die Herkunft und das genaue Alter der Löwenfiguren sind unbekannt. Man geht davon aus, dass sie entweder um 1150/1180, um 1300 oder um 1470 geschaffen wurden. Im christlichen Glauben symbolisiert der Löwe die Auferstehung von Jesus, weshalb es im Dom und in der Süderstadt zahlreiche Löwendarstellungen gab oder gibt. Wenn man die Löwen genauer betrachtet, haben sie jedoch kaum Ähnlichkeit mit echten Löwen. Die Figuren sind weit über 500 Jahre alt. Man muss also davon ausgehen, dass der damalige Steinmetz nie einen „echten“ Löwen gesehen hat. Zoos oder Fotos gab es schließlich noch nicht. Die Grundlage waren Überlieferungen: Man kann annehmen, dass ein Mensch voller Ehrfurcht oder Panik mal einen Löwen gesehen hat und dann anderen von diesem Erlebnis – oft verzerrt oder übertrieben – erzählt hat. Diese Erzählung wurde dann über Generationen hinweg weitergegeben. Der Steinmetz fertigte schließlich anhand dieser Schilderungen ein Abbild. Im Jahr 1530 kaufte die Bürgerschaft der Norderstadt dem damaligen Dekan Ratke Holste die beiden steinernen Löwen ab. Anschließend wurden sie am Zugang des Kaaks aufgestellt und wurden so zu den „Kaaklöwen“, auch wenn es eigentlich „Domlöwen“ sind.
Das mittelalterliche Rechtssystem unterschied
sich grundlegend von unserem heutigen. Damals
setzte man noch viel stärker auf eine
abschreckende Justiz. Die verhängten Strafen
wurden öffentlich vollzogen, um Nachahmer zu
verhindern – auch wenn es nur um Kleinigkeiten
wie Betrug oder kleineren Diebstahl ging.
Verurteilte wurden der öffentlichen Schande und
Kritik ausgesetzt, was der Abschreckung diente.
Neben der Schande wurde der Pranger
manchmal mit weiteren Maßnahmen kombiniert,
wie etwa der Zurschaustellung der Strafe vor der
Bevölkerung oder körperliche Züchtigungen.
Im Niederdeutschen wurde der Pranger als Kaak
bezeichnet – so auch in der Norderstadt von
Verden.
„Es war ein stürmischer Herbstnachmittag, als
ich – Elisabeth, Frau des Amtmanns von Verden
– bemerkte, dass ein wichtiges Schreiben
meines Mannes verschwunden war. Der Brief,
mit königlichem Siegel versehen, sollte noch
heute mit dem Boten nach Hannover gehen.
Ich hatte ihn selbst auf den Schreibtisch gelegt,
als mein Mann zur Verhandlung im Amtshaus
aufbrach.
Unruhig durchsuchte ich das Schreibzimmer.
Das Fenster stand offen – der Wind hatte
Papiere verweht, die Kerze flackerte. Ich rief
die Magd und befragte anschließend den
Jungen, der oft heimlich in der Vorratskammer
stöberte. Schließlich fand ich den Brief – feucht
und leicht zerknittert – unter dem Tisch, wo er
wohl vom Wind hinabgeweht worden war.
Ich schloss das Fenster, trocknete das Papier
vorsichtig am Herd und ließ sofort den Boten
rufen. Als mein Mann abends zurückkehrte,
sagte er nur trocken: „Du hast mir heute den
Tag gerettet.“ Ich lächelte still. Manches Amt
wird nicht im Amtshaus geführt – sondern
zwischen Ofen und Küche.“