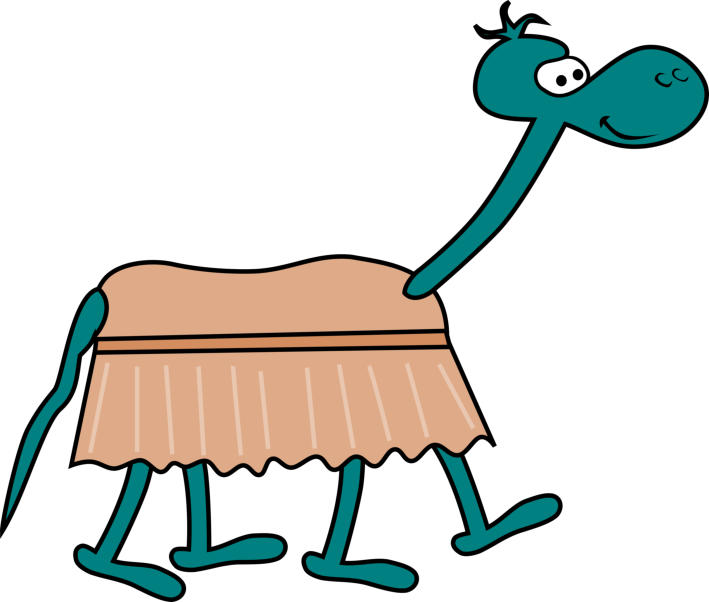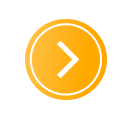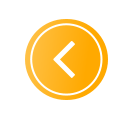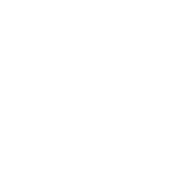Wäschepflege
Die Allerwiesen wurden zum Trocknen der alltäglichen Wäsche genutzt, denn in der Stadt gab es den Platz dafür nicht. Außerdem lag hier im Mittelalter und der Neuzeit das Gebiet der städtischen Bleiche. Schon um 1418 erwähnt, wurden auf den Allerwiesen gewebte Stoffe bzw. Leinen mit Holzpflöcken gespannt und in der Sonne geblichen. Zum Bleichen wählte man die Methode des sogenannten Rasenbleichens. Hierfür legte man die Stoffe flach aus und hielt sie feucht, indem man sie mit Pottasche-Lauge besprühte, um fettige Bestandteile zu entfernen. Durch das zusätzliche Bespritzen mit saurer Milch, auch „Ansäuern“ genannt, wurde der Bleicheffekt verstärkt. Dieser Prozess war sehr zeitintensiv und dauerte für Baumwolle bis zu drei Monate, für Leinen sogar bis zu sechs Monate. Schon damals standen auf den Allerwiesen die noch heute erhaltenen Gebäude (Pfadfinderhaus, Altes Hirtenhaus). Dort lebte unter anderem eine Aufsicht, die darüber wachte, dass niemand die Wäsche – vor allem die frisch gewebten Stoffe – klaute.
Die Wäschepflege war jahrhundertelang harte
Handarbeit, die von Frauen und Mädchen
verrichtet wurde. Die Wäsche wurde zunächst
mit Aschelauge versetzt und mit Holzstampfern
in einem Bottich bearbeitet. Im Laufe der
Geschichte wurden Seifen und Geräte entwickelt,
um das Waschen von Wäsche zu erleichtern.