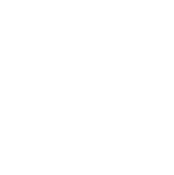Rathaus
Die Anfänge Emdens liegen in mehreren kleinen Warfen- oder Wurtendörfern, die sich im Laufe des Frühmittelalters im Bereich der jetzigen Altstadt bildeten. Es waren kleine friesische Handels- und Hafenplätze, die durch den damaligen fränkischen Landesausbau gegründet wurden. Im Bereich der südwestlichen Altstadt zwischen heutigem Rathaus und der Großen Kirche lag eine längliche Warf, die als Keimzelle Emdens gedeutet wird und aus zwei Wurten entstanden ist. Im Bereich der heutigen Ratsdelft (Hafenbecken) lag ein kleiner Priel, der als erster Hafen diente. Östlich der Ratsdelft befanden sich zwei weitere Dorfwurten, Klein- und Groß-Faldern, die im späten 16. Jahrhundert ein Teil von Emden wurden. Schon bald florierte der Hafen der kleinen Stadt Emden, sodass die frühe Siedlung an Bedeutung gewann. Im 11. Jahrhundert wurde sie zur Münzprägestätte und weitete ihre Handelsbeziehungen deutlich aus. Die Siedlung gehörte im Laufe des Hochmittelalters zu unterschiedlichen Territorien: den Grafen von Werl, den Bischöfen von Bremen und den Bischöfen von Münster. Ab dem späten 13. bzw. frühen 14. Jahrhundert ging die Siedlung an die Friesischen Häuptlinge über. Um 1300 errichteten die Grafen von Abdena im Bereich des heutigen Burgplatzes ein erstes festes Haus. Damit wurde Emden zu einem wichtigen Handelsplatz. Zu dieser Zeit florierte auch die Wirtschaft im südlich gelegenen Westfalen. Die dortigen Kaufleute nutzten den kurzen Weg nach Emden, um ihre Waren über Emden zu verschiffen. Verstärkt wurde dies durch den Stapelzwang von 1400, wodurch Emden zu einem bedeutenden Handelszentrum wurde. Aufgrund des Stapelzwangs und Piraterie kam es zu mehreren Auseinander- setzungen mit den Friesischen Häuptlingen, der Hanse und den benachbarten Niederlanden. Erst als das Stapelrecht 1494 vom damaligen Deutschen Kaiser Maximilian I. bestätigt wurde, beruhigte sich die Lage. Durch die Bestätigung des Stapelrechts florierte die Wirtschaft Emdens in den darauffolgenden etwa 200 Jahren und führte zur größten wirtschaftlichen Blüte der Stadt im 16. und 17. Jahrhundert. Befördert wurde der wirtschaftliche Aufschwung zusätzlich durch die Reformation, welche sich in Emden um 1520 vollzog. Dadurch kam es auch in den benachbarten Niederlanden zu massiven Verwerfungen und der Verfolgung der Protestanten. Ab etwa 1540 flohen tausende niederländische Glaubensflüchtlinge nach Emden, vor allem Händler und Handwerker. Vor dem Dreißigjährigen Krieg hatte Emden mehr als 18.000 Einwohner – um 1500 waren es gerade einmal 3.000 gewesen. Ursprünglich lag im Bereich der heutigen Deichstraße / Große Straße ein Versammlungs- haus der Kaufleute („Rathaus“), welches als Handels- und Kaufleutehaus genutzt wurde. Damals markierte der Ratsdelft als Hafen den östlichen Rand der Stadt. Um 1450 errichteten die stolzen Emder anstelle eines Brückentors über den Delft ein neues Rathaus. Als die Stadt im 16. Jahrhundert zu großem Reichtum gekommen war, wurde das Rathaus des 15. Jahrhunderts abgerissen und es entstand zwischen 1574 und 1576 ein neues, prächtiges renaissancezeitliches Rathaus. Während des Zweiten Weltkrieges wurde das alte Rathaus zu großen Teilen zerstört. Der heutige Rathausbau wurde 1962 eingeweiht.
Der Name Emden hat eine längere
Entwicklungsgeschichte. Er stammt von der
Einmündung des Flüsschens Ehe (oder Aa) in
die Ems ab. Früher nannte man diese Mündung
"Muhde". Daraus entstand zunächst der Name
Amuthon, im Mittelalter wurde daraus
Emuthon, später Embden und schließlich
Emden.

Höhenlinien der Stadtwurt von Emden
(ungefähre Lage)
Abbildung in Anlehnung an: Brandt et al [1994]










Quelle: https://www.wlz-online.de/panorama/emder-gegen-emdener-
5479572.html
Emder oder Emdener?
Offiziell sind beide Schreibweisen zulässig,
denn beides wird im Duden aufgeführt, auch
wenn die Emder darüber nicht gerade erfreut
sind. Sie selbst bezeichnen sich nämlich als
Emder und mögen gar nicht als Emdener
bezeichnet werden. Es gab auch schon
größeren Ärger, denn beispielsweise gibt es in
Berlin die Emdener Straße, was die Stadt
Emden gar nicht lustig findet. Schließlich
spricht man auch von Bremern und nicht von
Bremener – dieser Verglich ist nun auch für
Lugo schlüssig, sodass er nun immer von
Emdern redet.